Idiotenspiel
Meinhard Miegel (siehe unten: Nachlese) sieht als Ursache der Krise die Dominanz
Hartmut Rosa (Professor für Soziologie an der Universität Jena) geht es in "Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung" um die Bestimmung derjenigen sozialen Bedingungen und Voraussetzungen, die eine gelingende individuelle und kollektive Weltaneignung möglich machen, und die Frage, was eine kritische Soziologie durch Analyse der Veränderungen in der Welterfahrung, der Weltbeziehung und der Weltbearbeitung moderner Subjekte dazu beitragen kann. Das scheint mit interessanter und hilfreicher zu sein als Miegels schein-kritisches Geschwurbel.
Rosa fragt in der Einleitung (aus der Leseprobe):
Ist es möglich, mit den Mitteln der modernen Sozialwissenschaften
und auf der Basis der Einsichten der Sozialphilosophie eine Soziologie
des guten Lebens zu entwerfen? Deren Aufgabe bestünde nicht
darin, anzugeben, was die Ziele, die Werte oder die Inhalte eines
gelingenden Lebens sind – diese zu bestimmen ist ein Anliegen der
Philosophie des guten Lebens, doch sprechen gute Gründe für die
Annahme, dass sich solche Ziele, Werte und Inhalte allenfalls formal
bestimmen lassen –, sondern in der Identifizierung der sozialen
Voraussetzungen und Bedingungen eines solchen Lebens.1 In dem
vorliegenden Band möchte ich die Umrisse, Möglichkeiten und
Grenzen einer solchen Soziologie aus verschiedenen Blickwinkeln
versuchsweise ausloten. Als Ausgangspunkt für die Organisation
des Materials dient mir dabei die Vorstellung, dass sich die Frage
nach dem gelingenden Leben als eine Frage nach dem Weltverhältnis
oder der Weltbeziehung des Menschen reformulieren lässt
und dass diese Weltbeziehung stets sozial, kulturell und historisch
vermittelt ist. Der Begriff der ›Weltbeziehung‹ meint dabei die Art
und Weise, wie Menschen in die Welt gestellt sind oder, besser: in
der sie sich als in die Welt gestellt erfahren. Diese Stellung oder auch
Haltung der Welt gegenüber umfasst sowohl die eher passive Seite
der Welterfahrung als auch die aktive Weise des menschlichen Eingreifens
in die Welt; mithin also sowohl die Beziehung zu dem, was
den handelnden Subjekten ›entgegenkommt‹, als auch zu dem, was
es ›zu tun gibt‹....
Der gemeinsame, wenngleich nicht immer explizit gemachte
Fokus der folgenden Untersuchungen liegt nun in der Vermutung,
dass die Frage, unter welchen Bedingungen menschliches Leben
gelingt, sich übersetzen lässt in die Frage nach der Qualität oder
den Qualitäten der jeweiligen Weltbeziehung und dass dabei ein
fundamentaler, ja kategorialer Unterschied besteht zwischen einem
Modus des In-die-Welt-gestellt-Seins, bei dem diese Welt (in der
subjektiven, objektiven und/oder sozialen Dimension) dem Subjekt
als ein antwortendes, tragendes, atmendes ›Resonanzsystem‹
erscheint, und einer Weltbeziehung, der jene Welt als stumm, kalt
und indifferent – oder sogar als feindlich – erscheint....
Leitidee ist (...) die Vorstellung einer gelingenden
›Wiederaneignung‹ oder ›Anverwandlung‹ von Welt – einerseits,
kollektiv, im Modus demokratischer Politik, welche noch
immer das Versprechen der Antwort- oder ›Resonanzfähigkeit‹ der
kollektiven Strukturen und Voraussetzungen unseres Lebens birgt,
und andererseits, individuell, durch den Entwurf einer veränderten
Konzeption gelingenden Lebens. Lebensqualität, so versuche ich
im zehnten und letzten Beitrag zu zeigen, hängt nicht vom erreichten
oder erreichbaren materiellen Wohlstand und auch nicht von
der Summe an Lebensoptionen ab – sondern von der Möglichkeit
zu und vom Reichtum an Resonanzerfahrungen.
Die Grundgedanken finden sich auch in Hartmut Rosas Vortrag "Bis zum rasenden Stillstand. Beschleunigung und Entfremdung als Schlüsselbegriffe einer neuen Sozialkritik“, den Sie hier (dradio wissen) anhören können!
An anderer Stelle kritisiert Rosa den Verteilungsgerechtigkeits-UmFairteilungs-Mythos der Linken :
Das ist im Kapitalismus nicht anders als beim Mensch-ärgere-dich-nicht: Man hat Angst, aus dem Rennen geworfen zu werden, zurückzufallen, man hofft, sich an die Spitze setzen oder wenigstens ein paar Plätze aufrücken zu können, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Diese simple Spiellogik kann unglaubliche Leidenschaften entfachen, die erst dann verschwinden und sich relativieren, wenn man dem Spielbrett den Rücken kehrt. Die Linke jedoch fixiert alle Energien auf das Spielbrett: Die Abstände vergrößern sich! Die Manager haben nur Fünfer und Sechser auf dem Würfel! Sie haben viel mehr Männchen! Sie würfeln zweimal! Sie haben Schaum vor dem Mund!
Das ist alles richtig, und es ist kein harmloses Spiel, das hier gespielt wird, sondern eins auf Leben und Tod. Aber es gibt zwei Probleme mit ihm: Erstens, die Spielregeln sind ungerecht, die Gewinnchancen ungleich verteilt. Das ist das Problem der Gerechtigkeit, ein gewaltiges Problem für alle, die dem Feld hinterherlaufen müssen. Zweitens, es ist ein idiotisches Spiel, weil es keinerlei erkennbares Ende hat. Das ist das Problem der Entfremdung: Auch solche, die schon 20, 40 oder 400 Männchen im Ziel haben, werden weiter von den gleichbleibenden Angst- und Begehrensmustern angetrieben.
Der Kapitalismus beziehungsweise das Privateigentum, schreibt Marx in den frühen Pariser Manuskripten, sei nicht etwa die Ursache, sondern schon "das Produkt, das Resultat, die notwendige Konsequenz der entäußerten Arbeit, des äußerlichen Verhältnisses des Arbeiters zu der Natur und zu sich selbst", es ergebe sich "aus dem Begriff des entäußerten Menschen, der entfremdeten Arbeit, des entfremdeten Lebens, des entfremdeten Menschen"...
Idiotenspiel - von Hartmut Rosa, Le Monde diplomatique Nr. 9776 vom 13.4.2012
- expansionistischen Denkens, Fühlens und Handelns, das auch beim Euro Pate stand. Auch er ist vom Virus der Entgrenzung befallen, unter dem heute so viele Lebensbereiche leiden. Ob Managergehälter, Gütermengen oder staatliche Leistungen - alles wurde entgrenzt, und kaum einer bedenkt noch die Folgen...
Hartmut Rosa (Professor für Soziologie an der Universität Jena) geht es in "Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung" um die Bestimmung derjenigen sozialen Bedingungen und Voraussetzungen, die eine gelingende individuelle und kollektive Weltaneignung möglich machen, und die Frage, was eine kritische Soziologie durch Analyse der Veränderungen in der Welterfahrung, der Weltbeziehung und der Weltbearbeitung moderner Subjekte dazu beitragen kann. Das scheint mit interessanter und hilfreicher zu sein als Miegels schein-kritisches Geschwurbel.
Rosa fragt in der Einleitung (aus der Leseprobe):
Ist es möglich, mit den Mitteln der modernen Sozialwissenschaften
und auf der Basis der Einsichten der Sozialphilosophie eine Soziologie
des guten Lebens zu entwerfen? Deren Aufgabe bestünde nicht
darin, anzugeben, was die Ziele, die Werte oder die Inhalte eines
gelingenden Lebens sind – diese zu bestimmen ist ein Anliegen der
Philosophie des guten Lebens, doch sprechen gute Gründe für die
Annahme, dass sich solche Ziele, Werte und Inhalte allenfalls formal
bestimmen lassen –, sondern in der Identifizierung der sozialen
Voraussetzungen und Bedingungen eines solchen Lebens.1 In dem
vorliegenden Band möchte ich die Umrisse, Möglichkeiten und
Grenzen einer solchen Soziologie aus verschiedenen Blickwinkeln
versuchsweise ausloten. Als Ausgangspunkt für die Organisation
des Materials dient mir dabei die Vorstellung, dass sich die Frage
nach dem gelingenden Leben als eine Frage nach dem Weltverhältnis
oder der Weltbeziehung des Menschen reformulieren lässt
und dass diese Weltbeziehung stets sozial, kulturell und historisch
vermittelt ist. Der Begriff der ›Weltbeziehung‹ meint dabei die Art
und Weise, wie Menschen in die Welt gestellt sind oder, besser: in
der sie sich als in die Welt gestellt erfahren. Diese Stellung oder auch
Haltung der Welt gegenüber umfasst sowohl die eher passive Seite
der Welterfahrung als auch die aktive Weise des menschlichen Eingreifens
in die Welt; mithin also sowohl die Beziehung zu dem, was
den handelnden Subjekten ›entgegenkommt‹, als auch zu dem, was
es ›zu tun gibt‹....
Der gemeinsame, wenngleich nicht immer explizit gemachte
Fokus der folgenden Untersuchungen liegt nun in der Vermutung,
dass die Frage, unter welchen Bedingungen menschliches Leben
gelingt, sich übersetzen lässt in die Frage nach der Qualität oder
den Qualitäten der jeweiligen Weltbeziehung und dass dabei ein
fundamentaler, ja kategorialer Unterschied besteht zwischen einem
Modus des In-die-Welt-gestellt-Seins, bei dem diese Welt (in der
subjektiven, objektiven und/oder sozialen Dimension) dem Subjekt
als ein antwortendes, tragendes, atmendes ›Resonanzsystem‹
erscheint, und einer Weltbeziehung, der jene Welt als stumm, kalt
und indifferent – oder sogar als feindlich – erscheint....
Leitidee ist (...) die Vorstellung einer gelingenden
›Wiederaneignung‹ oder ›Anverwandlung‹ von Welt – einerseits,
kollektiv, im Modus demokratischer Politik, welche noch
immer das Versprechen der Antwort- oder ›Resonanzfähigkeit‹ der
kollektiven Strukturen und Voraussetzungen unseres Lebens birgt,
und andererseits, individuell, durch den Entwurf einer veränderten
Konzeption gelingenden Lebens. Lebensqualität, so versuche ich
im zehnten und letzten Beitrag zu zeigen, hängt nicht vom erreichten
oder erreichbaren materiellen Wohlstand und auch nicht von
der Summe an Lebensoptionen ab – sondern von der Möglichkeit
zu und vom Reichtum an Resonanzerfahrungen.
Die Grundgedanken finden sich auch in Hartmut Rosas Vortrag "Bis zum rasenden Stillstand. Beschleunigung und Entfremdung als Schlüsselbegriffe einer neuen Sozialkritik“, den Sie hier (dradio wissen) anhören können!
An anderer Stelle kritisiert Rosa den Verteilungsgerechtigkeits-UmFairteilungs-Mythos der Linken :
Das ist im Kapitalismus nicht anders als beim Mensch-ärgere-dich-nicht: Man hat Angst, aus dem Rennen geworfen zu werden, zurückzufallen, man hofft, sich an die Spitze setzen oder wenigstens ein paar Plätze aufrücken zu können, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Diese simple Spiellogik kann unglaubliche Leidenschaften entfachen, die erst dann verschwinden und sich relativieren, wenn man dem Spielbrett den Rücken kehrt. Die Linke jedoch fixiert alle Energien auf das Spielbrett: Die Abstände vergrößern sich! Die Manager haben nur Fünfer und Sechser auf dem Würfel! Sie haben viel mehr Männchen! Sie würfeln zweimal! Sie haben Schaum vor dem Mund!
Das ist alles richtig, und es ist kein harmloses Spiel, das hier gespielt wird, sondern eins auf Leben und Tod. Aber es gibt zwei Probleme mit ihm: Erstens, die Spielregeln sind ungerecht, die Gewinnchancen ungleich verteilt. Das ist das Problem der Gerechtigkeit, ein gewaltiges Problem für alle, die dem Feld hinterherlaufen müssen. Zweitens, es ist ein idiotisches Spiel, weil es keinerlei erkennbares Ende hat. Das ist das Problem der Entfremdung: Auch solche, die schon 20, 40 oder 400 Männchen im Ziel haben, werden weiter von den gleichbleibenden Angst- und Begehrensmustern angetrieben.
Der Kapitalismus beziehungsweise das Privateigentum, schreibt Marx in den frühen Pariser Manuskripten, sei nicht etwa die Ursache, sondern schon "das Produkt, das Resultat, die notwendige Konsequenz der entäußerten Arbeit, des äußerlichen Verhältnisses des Arbeiters zu der Natur und zu sich selbst", es ergebe sich "aus dem Begriff des entäußerten Menschen, der entfremdeten Arbeit, des entfremdeten Lebens, des entfremdeten Menschen"...
Idiotenspiel - von Hartmut Rosa, Le Monde diplomatique Nr. 9776 vom 13.4.2012
gebattmer - 2012/08/15 18:40

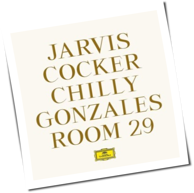


















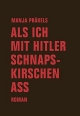



















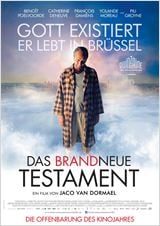


















Trackback URL:
https://gebattmer.twoday-test.net/stories/129657662/modTrackback