Wenn Hirnforschung Sozialwissenschaft ist
Es stand zu lesen
unter dem Titel
VON MÄUSEN UND MENSCHEN
ein Artikel von
Matthias Greffrath
in der TAZ
Vor einigen Wochen hörte ich einen Vortrag des Gehirnforschers Gerald Hüther. Auch er projizierte Gehirn-Scans, die zeigten, wie irrwitzig wenige unserer zerebralen Möglichkeiten wir nutzen, wie formbar und verletzlich unsere Intelligenz ist, wie abhängig unser mentales Wachstum von Erfahrungen. Das alles unterschied ihn nicht von seinen Kollegen. Aber dann kam der Satz, der den Horizont verschob: “Die Gehirnforschung ist eine Sozialwissenschaft!”
Das Gehirn ist ein soziales Organ. Und Leben ist Lernen. Schon lange vor der Geburt. Und nicht erst beim Menschen.
So verblasst der Glanz der Gene im Licht der Entwicklungsbiologie. Vielleicht wird von ihrer determinierenden Rolle nur die Form unserer Nasen bleiben und die Länge unserer Beine.
Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, dann kommt es darauf an, die Umstände menschlich zu bilden. Das ist ein Gemeinplatz. Interessant ist nur, dass nun die isolierende Naturwissenschaft vom Menschen uns mit Fotos aus dem Inneren unserer Seelenapparate “beweisen” kann, dass der Humanismus - und seine Normen - ein Fundament in unserer Natur finden. Und da geht es um weit mehr als um Intelligenz. Kinder der Liebe, von Eltern ohne Zukunftsangst, werden gesünder und kräftiger - so steht es in Kleists “Brief an einen jungen Maler”. Das ist Poesie. Und nun kommt aus dem Magnetresonanztomografen die Bestätigung: Es stimmt.
Der Vortrag des Neurobiologen erinnert mich an einen anderen, den ich vor Jahren hörte. Der Molekularbiologe Gottfried Schatz (sagte), die “Gnade unseres großen Genoms” erlaube es uns, zu lernen, unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Darin läge die Menschenwürde.
Oder: die Würde des Lebens überhaupt. Und seine Schönheit.
In unserer Zivilisation werden diese Erkenntnisse zum Bau immer neuer chemischer Krücken benutzt, die uns helfen, in der Welt, wie sie nun einmal ist, zurechtzukommen.
Sie könnten aber auch ganz anders wirken:
Eine Embryologie, die nicht die Retortenzeugung perfektioniert, sondern mit Technik und Fantasie die vorgeburtlichen Erfahrungswelten nachvollziehbar macht; eine Biochemie, die uns nicht Oxytozinpräparate gegen Bindungsangst beschert, sondern auch etwas über Verhältnisse sagt, die Vertrauen in Menschen produzieren; eine Molekularbiologie, die uns erzählt, dass wir von weit kommen und noch weit gehen könnten, und damit den “mystischen Gefühlen” der Religion eine reale Basis gibt.
Wir haben zwei Wissenskulturen, heißt es immer. Das stimmt, aber ich vermute, die Grenze verläuft nicht zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, sondern hängt davon ab, was wir wissen wollen von den gesellschaftlichen Verhältnissen, unter denen wir wissen wollen.
via michael.schmidt @ Tagesspiegel Weblogs
Da in der Nähe auch:
Hirnforscher Manfred Spitzer: "Kinder lernen besser ohne Computer"
... könnte ja was dran sein! Lesen (am Computer)!
unter dem Titel
VON MÄUSEN UND MENSCHEN
ein Artikel von
Matthias Greffrath
in der TAZ
Vor einigen Wochen hörte ich einen Vortrag des Gehirnforschers Gerald Hüther. Auch er projizierte Gehirn-Scans, die zeigten, wie irrwitzig wenige unserer zerebralen Möglichkeiten wir nutzen, wie formbar und verletzlich unsere Intelligenz ist, wie abhängig unser mentales Wachstum von Erfahrungen. Das alles unterschied ihn nicht von seinen Kollegen. Aber dann kam der Satz, der den Horizont verschob: “Die Gehirnforschung ist eine Sozialwissenschaft!”
Das Gehirn ist ein soziales Organ. Und Leben ist Lernen. Schon lange vor der Geburt. Und nicht erst beim Menschen.
So verblasst der Glanz der Gene im Licht der Entwicklungsbiologie. Vielleicht wird von ihrer determinierenden Rolle nur die Form unserer Nasen bleiben und die Länge unserer Beine.
Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, dann kommt es darauf an, die Umstände menschlich zu bilden. Das ist ein Gemeinplatz. Interessant ist nur, dass nun die isolierende Naturwissenschaft vom Menschen uns mit Fotos aus dem Inneren unserer Seelenapparate “beweisen” kann, dass der Humanismus - und seine Normen - ein Fundament in unserer Natur finden. Und da geht es um weit mehr als um Intelligenz. Kinder der Liebe, von Eltern ohne Zukunftsangst, werden gesünder und kräftiger - so steht es in Kleists “Brief an einen jungen Maler”. Das ist Poesie. Und nun kommt aus dem Magnetresonanztomografen die Bestätigung: Es stimmt.
Der Vortrag des Neurobiologen erinnert mich an einen anderen, den ich vor Jahren hörte. Der Molekularbiologe Gottfried Schatz (sagte), die “Gnade unseres großen Genoms” erlaube es uns, zu lernen, unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Darin läge die Menschenwürde.
Oder: die Würde des Lebens überhaupt. Und seine Schönheit.
In unserer Zivilisation werden diese Erkenntnisse zum Bau immer neuer chemischer Krücken benutzt, die uns helfen, in der Welt, wie sie nun einmal ist, zurechtzukommen.
Sie könnten aber auch ganz anders wirken:
Eine Embryologie, die nicht die Retortenzeugung perfektioniert, sondern mit Technik und Fantasie die vorgeburtlichen Erfahrungswelten nachvollziehbar macht; eine Biochemie, die uns nicht Oxytozinpräparate gegen Bindungsangst beschert, sondern auch etwas über Verhältnisse sagt, die Vertrauen in Menschen produzieren; eine Molekularbiologie, die uns erzählt, dass wir von weit kommen und noch weit gehen könnten, und damit den “mystischen Gefühlen” der Religion eine reale Basis gibt.
Wir haben zwei Wissenskulturen, heißt es immer. Das stimmt, aber ich vermute, die Grenze verläuft nicht zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, sondern hängt davon ab, was wir wissen wollen von den gesellschaftlichen Verhältnissen, unter denen wir wissen wollen.
via michael.schmidt @ Tagesspiegel Weblogs
Da in der Nähe auch:
Hirnforscher Manfred Spitzer: "Kinder lernen besser ohne Computer"
... könnte ja was dran sein! Lesen (am Computer)!
gebattmer - 2007/06/26 21:58

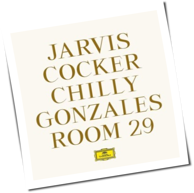


















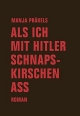



















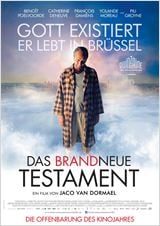


















Trackback URL:
https://gebattmer.twoday-test.net/stories/3992888/modTrackback